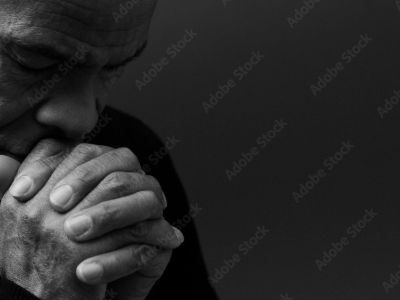Verzicht statt Völlerei im Advent: Wo der Karpfen der Heilige unter den Fischen ist

Man muss im November nur einmal um die Riddagshäuser Teiche spazieren, um das zu verstehen. Erst 1934 in die Stadt Braunschweig eingemeindet, blickt Riddagshausen auf eine bald neunhundertjährige bewegte und stolze Geschichte zurück. Mit der Ankunft des Konvents aus Amelungsborn und Gründung des Klosters Anno Domini 1145 (zunächst unter dem Namen Mariazelle), erscheint das Dorf „villam qui dicitus Ritdageshvsen“ im Jahr darauf erstmals urkundlich, als Heinrich der Löwe es dem jungen Kloster als Erstausstattung überträgt.
Von nun an machten sich die fleißigen und kundigen Zisterzienser ans Werk.
Jene asketischen Erben der Benediktiner, die beschlossen hatten, der Dekadenz der alten Klöster zu entfliehen. Ihr Mutterkloster in der sumpfigen und wasserreichen Landschaft Burgunds nannten sie Cîteaux/ lat. Cistercium – nach den dortigen Zisternen, den Speicherbecken für Regenwasser. Der Reform-Orden wollte zurück zu den ursprünglichen Idealen, zu ora et labora, zu Einfachheit und Strenge, Selbstversorgung, zur Abkehr von Filz, Städten und Machtzentren und zu disziplinierten Speiseregeln.
Kein Wein, kein Fleisch, kein Gold, keine Glasmalerei
Kein Prunk und Protz und keine Orgel. Nur Arbeit, Wasser und Gotteslob in einstimmigen Choralgesängen. Doch weil man von Gebeten allein bekanntlich nicht satt wird, entdeckten sie den Fisch für sich. Überdies gehört er zu den ältesten Symbolen des Christentums.
Im frühen Rom nutzten Christen ihn als geheimes Erkennungszeichen, weil das griechische Wort „Ichthys“ („Fisch“) zugleich ein Akronym war: Iēsous Christos Theou Hyios Sōtēr – „Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser“. Außerdem knüpft der Fisch an viele neutestamentarische Motive an.
Wo immer die frommen Wasserbauern nun also hinkamen und sesshaft wurden, besonders in Böhmen, Bayern, Franken, Österreich und Süddeutschland, gruben sie Becken, stauten Bäche, legten Gräben und Kanäle an und entwickelten eine ausgefeilte Fischzuchtkultur. Sie wurden zu Ingenieuren des Göttlichen: Wer das Wasser und die stille Logik klösterlicher Besonnenheit beherrschte, beherrschte auch die Zeit – den Kreislauf von Saat, Pflege, Ernte und Fest.
Riddagshausen, mitten in der norddeutschen Ebene, war dabei ihr nördlichstes Labor
Das heutige Naturschutzgebiet, in dem immer noch traditionelle Fischwirtschaft betrieben wird, war bereits im 12. Jahrhundert ein präzise orchestriertes Wasserwunder: eine Teichkette von raffinierter Eleganz. Jeder Teich hat seinen Zweck – Laichteich, Hälterteich, Abfischteich. Selbst das steuerbare Abzugsbauwerk, das ausgeklügelte System aus Rückhalt, Abfluss und Überlauf, heißt heute im Fachjargon noch „Mönch“.
Was einst als Rückkehr zur Reinheit begann, wurde damit zur Kunstform des Wartens erhoben- in jedem Wortsinn. Und hier tritt übrigens auch der traditionsreiche Weihnachts-Karpfen auf die Bühne der Historie. Er war genügsam, wuchs langsam, ließ sich in den Klosterteichen gut hältern und hatte das Wesen eines Klosterbruders: friedlich, ein bisschen träge, leicht melancholisch.
In gewisser Weise war der Karpfen der Heilige unter den Fischen, ein schwimmender Kompromiss zwischen Bedürfnis und Buße. Wenn er am Heiligen Abend, dem halben Fasttag, vor der Mitternachtsmette als Mahl gereicht wird, dann glänzt er in Butter oder Brühe. Und er trägt in seinem grätenreichen Leib das ganze Programm klösterlicher Dialektik: Disziplin, Geduld und die stille Einsicht, dass alles Mühsame irgendwann genießbar wird, wenn man es nur lange genug wendet (und wässert).
Die Ironie der Geschichte will es jedoch, dass der Advent sich längst in sein Gegenteil verkehrt hat
Einst eine Zeit der Einkehr und des Verzichts in der Erwartung auf Jesu Geburt, wird jetzt der Völlerei im Vorverkauf gefrönt. Meist geht es schon Mitte November los, da man die Trostlosigkeit, Stille, Dunkelheit, die Nässe und den Nebel nicht aushalten und schnellstmöglich überbrücken möchte.
Aus besinnlicher Hoffnung wird grelle Hektik. Viele Städte schalten mittlerweile schon lange vor Totensonntag die mitunter aufdringliche Festbeleuchtung ein. Glühwein, Mandeln, Schokolade und Spekulatius stehen so regelmäßig auf dem Speiseplan wie fette Gänsekeulen auf jeder Weihnachtsfeier im Wochentakt, die Kegelklub, Betrieb und Skatverein ausgerichtet haben.
Spätestens am 24. Dezember sitzen wir dann mit glasigem Blick über dem fünften Festmahl in Folge und merken, dass eine vorweihnachtliche, mehrwöchige Zurückhaltung durchaus bekömmlich gewesen wäre.
Vielleicht sollte man in diesem Advent einmal das Fasten wieder probieren – nicht als Diät, sondern als Geste der Wiederverzauberung.
Vielleicht genügt es, an einem winterlichen, trüben Tag an den Teichen von Riddagshausen zu stehen und zu lauschen, wie das Wasser gluckst, während die Amsel durch den Schilfsaum hüpft. Und dann, irgendwo zwischen Dunst und Dämmerung, wird einem klar: Dinge in Ruhe erwarten zu können, ist der wahre Geist des Advents.
Neueste Glaube
Spendenaufruf
+++ Haben Sie Interesse an politischen Analysen wie diesen?
+++ Dann unterstützen Sie unsere Arbeit
+++ Mit einer Spende über PayPal@TheGermanZ
oder einer Überweisung auf unser Konto DE03 6849 2200 0002 1947 75 +++
Klaus Kelle, Chefredakteur