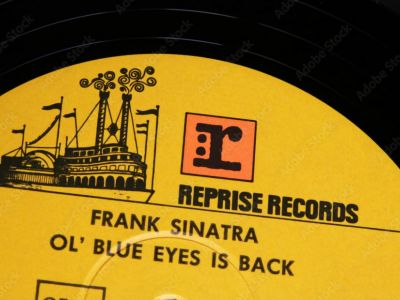Der Aufstieg eines unbeschriebenen Blattes in die große Politik

Angela Merkel war keine Bürgerrechtlerin, wie fast alle ihre Biografen irgendwie nahelegen wollen. Aber sie sah, wie kaum ein anderer, in der Friedlichen Revolution und dem Vereinigungsprozess ihre Chance. Sie erzählte gern – auch mir – wie sie sich nach dem Mauerfall, als es ungefährlich wurde, aufmachte, um Anschluss an die neu entstandenen politischen Bewegungen zu suchen. Ihre erste Wahl war die SDP, wie die neu gegründeten Sozialdemokraten der DDR ein paar Wochen lang hießen.
Sie traf im ersten richtigen Büro der jungen Partei ein, das sich im „Haus der Demokratie“ in der Berliner Friedrichstraße befand.
Der ehemalige Sitz der SED-Bezirksleitung Berlin war vom neuen Parteivorsitzenden der SED-PDS Gregor Gysi den neu gegründeten Parteien „geschenkt“ worden. Im Büro saß Angelika Barbe, Bürgerrechtlerin und Mitbegründerin der SDP. Barbe kannte Merkel natürlich nicht, war aber überrascht, mit welchem Anspruch unter Berufung auf ihren Doktortitel sie auftrat. Merkel wollte gleich ganz oben mitmachen. Barbe er-widerte, das sei so nicht möglich, Merkel müsse sich an den für ihren Wohnort zuständigen Kreisverband wenden. Das wollte Merkel nicht.
Man trennte sich kühl. Merkel gab später als Begründung an, sie hätte Barbe so unmöglich gefunden, dass die Sozialdemokraten für sie nicht mehr infrage kamen.
Ihre nächste Station war der Demokratische Aufbruch, der damals noch vom guten Bekannten ihres Vaters, dem Kirchenjuristen Wolfgang Schnur geleitet wurde. Der DA war wesentlich kleiner als die SDP, Personal im Büro war knapp, also konnte sie gleich „ganz oben“ als Pressesprecherin der Partei.
Schnur sah sich nach der Gründung der „Allianz für Deutschland“, dem ein kleinerer Teil des DA beigetreten war, im Wahlkampf für die erste und letzte frei gewählte Volkskammer der DDR schon als künftigen Ministerpräsidenten. Er wurde von den meisten Medien auch so hofiert. Etwas von dem Glanz fiel dabei natürlich auf Merkel.
Ich war damals Spitzenkandidatin der Grünen Partei der DDR und ihre Pressesprecherin, saß also auch im „Haus der Demokratie“, nur wenige Büros entfernt von Merkel. Eines nachmittags kurz vor der Wahl bekam ich Besuch vom Vorstand des Demokratischen Aufbruchs und von Merkel. Ich sah in verwirrte Gesichter. Es dauerte etwas, bis einer das Wort ergriff.
Man hätte Informationen bekommen, dass Wolfgang Schnur Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen sei. Von mir wollten sie wissen – da Wolfgang Schnur mein Anwalt gewesen war, als ich im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen saß –, was ich dazu meinen würde. Ich konnte die Leute nicht beruhigen. Ich musste ihnen sagen, dass ich als Gefangene der Staatssicherheit Schnur als jemanden erlebt hatte, der im Auftrag der Staatssicherheit handelte, und dass ich das schon 1988 im „Friedrichsfelder Feuermelder“, einer Publikation der Opposition, veröffentlicht hatte.
Bei dieser Gelegenheit lernte ich Merkel kennen. Sie machte mir aufgebracht Vorwürfe, ich verbreite üble Nachrede. Zwei Tage später stand die Nachricht über Schnurs Stasitätigkeit in allen Medien und Merkel forderte gegenüber der Presse sehr effektiv Aufklärung. Schnur wurde als Spitzenkandidat der Allianz für Deutschland durch Lothar de Maizière ersetzt, der dann nach einem grandiosen Wahlsieg der „Allianz für Deutschland“ letzter Ministerpräsident der DDR wurde. Für Merkel bedeutete das eine höhere Stufe auf der politischen Karriereleiter. Sie wurde de Maizières Stellvertretende Regierungssprecherin. Wobei mich stutzig machte, als ich las, dass de Maizière auf Fragen von Journalisten antwortete, Merkel sei ihm vorgestellt worden. Sie sei ihm vorher nicht bekannt gewesen. Wie glaubhaft ist das? Immerhin haben Merkels Vater und Clemens de Maizière, der Vater von Lothar, in der Evangelischen Kirche der DDR eng zusammengearbeitet.
Bekanntlich ging die DDR schneller zu Ende, als die Politiker aller Seiten erwartet hatten. Am 3. Oktober 1990 erfolgte die Vereinigung und im Dezember dieses Jahres wurde der erste gemeinsame Bundestag gewählt. Angela Merkel trat als direkt zu wählende Abgeordnete des Wahlkreises 15 (Stralsund, Landkreis Nordvorpommern und Landkreis Rügen) an. Wie es dazu kam, hat sie mir selbst erzählt. Es war der ostdeutsche Chefunterhändler des Vereinigungsvertrages Günther Krause, der Merkel darauf aufmerksam machte, dass auf Rügen eventuell die Möglichkeit bestand, sich den Wahlkreis Stralsund/Rügen/Grimmen zu erobern. Er machte Merkel mit dem späteren Landrat Wolfhardt Molkentin bekannt, der über keinen geeigneten Kandidaten für die Bundestagswahl verfügte.
Mit seinem Einverständnis warf sie ihren Hut gegen die Kandidaten aus Rügen und Stralsund, die beide aus dem Westen kamen, in den Ring.
Die Wahl fand auf Rügen statt, und zwar in Prora, dem KDF-Bau der Nazis, der damals noch Kaserne der Nationalen Volksarmee war. Molkentin hatte für die Wahl zwei Busse organisiert. Es gab noch keine Wahlmänner, sondern die Basis wählte. Im ersten Wahlgang erhielt der Kandidat aus Rügen die Mehrheit der Stimmen. Damit hatte sich für seine Unterstützer die Sache erledigt. Viele gingen nach der Auszählung nach Hause. Landwirte müssen morgens früh aufstehen. Sie wussten nicht, dass ihr Kandidat, weil er nicht die absolute Mehrheit erhalten hatte, in einem zweiten Wahlgang bestätigt werden musste. Im zweiten Wahlgang hatten die ohnehin auf den Bus wartenden Wähler aus Grimmen die Mehrheit, denn sie waren weiter anwesend. Merkel gewann diesen Wahlkreis dann insgesamt achtmal.
Ich begegnete ihr wieder, als der erste gemeinsame Bundestag im Reichstag in Berlin zusammentrat. Aus irgendeinem Grund hatte uns der Fahrdienst ein gemeinsames Auto zugewiesen. Ich saß mit Merkel und ihrem künftigen Ehemann Joachim Sauer auf dem Rücksitz (er in der Mitte). Merkel sprach mich ziemlich aufgebracht auf eine Veröffentlichung von Bild an, in der neue Frauen für den Bundestag vorgestellt wurden.
Das waren sie für die CDU, Elke Leonhard für die SPD und ich für Bündnis 90/Grüne. An die FDP und die PDS-Abgeordnete kann ich mich nicht mehr erinnern. Merkel regte sich auf, dass Elke Leonhard mit einem dreimal so großen Foto abgebildet war als die Übrigen. Wenn, dann hätten doch Andere das verdient, zum Beispiel ich. Ihr war aber deutlich anzumerken, dass sie dabei nicht an mich, sondern an sich dachte. Meine nicht ganz ernst gemeinte Antwort, Elke Leonhardt wäre eben die Schönste von uns, erboste sie noch mehr. Ich wüsste wohl nicht, wie wichtig die Presse sei, das sollte ich besser ganz schnell begreifen.
Warum war eigentlich Lothar de Maizière, der als letzter Ministerpräsident der DDR der geborene Vizekanzler des vereinten Deutschlands gewesen wäre, im ersten gemeinsamen Bundestag nur noch als einfacher Abgeordneter dabei?
Diese Geschichte hat mir Helmut Kohl erzählt.
Gerüchte über eine Stasi-Mitarbeit von Lothar de Maizière hat es seit dem Runden Tisch gegeben, der in den letzten Monaten der DDR eine Art Nebenregierung war. Sie wurden nicht ernst genommen beziehungsweise als böswillige Diffamierung angesehen. Im Spätsommer 1990, als die Vereinigung und die Wahl des ersten gemeinsamen Bundestages absehbar war, wurde Bundeskanzler Kohl von Journalisten damit konfrontiert, dass de Maizière Mitarbeiter der Staatssicherheit mit dem Decknamen „Czerny“ gewesen sei.
Das war nach Wolfgang Schnur der zweite spektakuläre Fall in der Allianz für Deutschland. Die Sozialdemokraten waren nicht viel besser dran, denn mit Ibrahim Böhme wurde ihr Parteivorsitzender kurz vor Zusammentritt der ersten frei gewählten Volkskammer als Mitarbeiter der Stasi enttarnt. Offensichtlich hatten auch die Journalisten kein so großes Interesse an einem weiteren spektakulären Fall, also einigte man sich folgendermaßen: Kohl würde dafür sorgen, dass de Maizière keine Führungsposition mehr bekam, dafür würde seine Enttarnung zwar gemeldet, aber nicht zu einer großen Sache aufgebauscht werden. In dem Gespräch, in dem Kohl de Maizière anbot, ein geachtetes Mitglied der Partei zu bleiben, wenn er sich ohne Aufsehen aus der Führung zurück- zöge, willigte der ein, sagte aber, dass Kohl doch neben Günther Krause noch eine zweite Person aus der ehemaligen DDR für sein Kabinett brauche, am besten eine Frau. Er schlug Angela Merkel vor. Kohl akzeptierte diesen Vorschlag. Eine Bestätigung, dass es so abgelaufen ist, fand ich im Buch von Wolfgang Stock „Angela Merkel – eine politische Biografie“.
Stock berichtet, dass Merkel in den entscheidenden Tagen Lothar de Maizière im Kanzleramtspark in Bonn über den Weg gelaufen ist und von ihm gehört hat: „Dir kann es passieren, dass der Bundeskanzler dich anruft, du sollst Ministerin werden.“ De Maizière setzte seiner politischen Laufbahn dann selbst ein Ende.
Ende August 1991 gab er in einer Vorstandssitzung völlig überraschend eine Erklärung ab, dass er aus dem CDU-Vorstand zurücktreten werde.
Im September gab er auch sein Bundestagsmandat auf.
Er verabschiedete sich mit einem Eklat, indem er die CDU beschuldigte, sich an 26 Millionen Mark aus dem Vermögen der Ost-CDU bereichert zu haben.
Nach gewonnener Wahl wurde das ehemalige Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit in drei Teile zerlegt: Frauen und Jugend bekam Angela Merkel, Familie und Senioren Hannelore Rönsch und Gesundheit Gerda Hasselfeldt. Im Dezember 1991 wurde Angela Merkel außerdem auf dem CDU-Bundesparteitag in Dresden als Nachfolgerin von Lothar de Maizière zur einzigen stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei gewählt, ab 1992 war sie eine von vier Stellvertretern Kohls.
Merkel hatte aber nie einen Antrag auf Mitgliedschaft in der CDU gestellt. Wie Wikipedia das vornehm umschreibt, erfolgte ihre Mitgliedschaft „passiv“ durch Umwandlung ihrer DA-Mitgliedschaft in eine der CDU. Das ist mehr als eine Nebensächlichkeit. Wie das Buch von Ewald König „Merkels Welt zur Wendezeit“ enthüllte, hatte Merkel in den Revolutionswochen nach dem Mauerfall ihre grundlegende Abneigung gegen die CDU erklärt. Diese Abneigung wandelte sich auch nicht, als sie längst Ministerin und später Parteivorsitzende war. Als ich ihr einmal vorsichtig vorschlug, ihre Kleidung und Frisur zu optimieren, lehnte sie ab mit den Worten: „Ich will doch nicht aussehen wie eine CDU-Tussi.“ Es bleibt nur die Schlussfolgerung, dass Merkel die CDU als Trittbrett für ihre politische Karriere gekapert hat.
Die Art und Weise, wie sie die CDU entsorgte, als sie ihr nicht mehr nützlich sein konnte, stützt diese These. Ich komme am Ende darauf zurück.
Der Einzug in den Bundestag 1990 war für die ostdeutschen Abgeordneten die Ankunft in einer neuen Welt. Besonders die Abgeordneten der letzten Volkskammer der DDR mussten umdenken. In den drei Monaten vom 4. Oktober bis Anfang Dezember war die Lage im Wasserwerk in Bonn unübersichtlich. Ein Drittel der Volkskammer-Abgeordneten wurde kurzzeitig zu Mitgliedern des Bundestages. In den wenigen Monaten ihrer Existenz war die Volkskammer das vielleicht freieste Parlament der Welt.
Zwar bemühten sich die westdeutschen Berater aller Fraktionen, den Abgeordneten „Disziplin“ beizubringen, waren aber nur eingeschränkt erfolgreich. Selbst im Plenum gelang es ab und zu, für den eigenen Antrag mit guten Argumenten Stimmen aus den anderen Fraktionen zu bekommen. Entscheidend war das eigene Gewissen, nicht die Parteimeinung.
Ich weiß nicht mehr, um welche Abstimmung es in Bonn ging, als ein Hammelsprung angeordnet werden musste, um herauszufinden, wie die Stimmverhältnisse waren. Bei einem Hammelsprung verlassen alle Ab- geordneten den Saal und kehren durch drei Türen – Ja, Nein, Enthaltung – zurück. Ich war im Gespräch mit einem CDU-Abgeordneten aus Thüringen unterwegs zur Tür mit Nein, als drei Abgeordnete seiner Fraktion kamen, ihn freundschaftlich unter die Arme griffen und ihn sanft, aber bestimmt durch die Ja-Tür schoben.
Angela Merkel, als sie im Dezember dazukam, musste diesbezüglich nicht umdenken. Die Frau, die von einem Kollegen später als „lernende Maschine“ bezeichnet wurde, begriff früher als die meisten Anderen, worauf es ankam. Das wurde mir klar, als ich mit Merkel, kaum in Bonn angekommen, zu einem Abend mit Juristinnen eingeladen wurde.
Wir hielten beide unsere Vorträge und mussten dann die Fragen unserer Zuhörerinnen beantworten. Merkel sprach davon, dass sie sich schnellstens eine Hausmacht schaffen müsste. Sie schien auch schon zu wissen, wie man das anstellt. Allerdings dauerte es Jahre, bis sie so weit war. Bis dahin profitierte sie von der Protektion, die ihr Helmut Kohl und besonders Volker Rühe, der damalige Verteidigungsminister und neben Wolfgang Schäuble einer der beiden „Kronprinzen“ des Bundeskanzlers, angedeihen ließen. Von den Medien wurde sie „Kohls Mädchen“ genannt – wofür sie sich Jahre später bitter gerächt hat.
Mir ist in Erinnerung, dass sie in einem ziemlich gehässigen Kommentar mit Biene Maja verglichen wurde, die total überrascht war, dass sie ganz vorn mitfliegen durfte. Dies war eine groteske Unterschätzung des Autors, aber man darf nicht vergessen, dass unterschätzt zu werden, lange Merkels Stärke war. Sie konnte unterhalb des Radars misstrauischer Parteifreunde ihr Netzwerk aufbauen. In der Fraktion saß sie nicht vorn am langen Vorstandstisch, sondern bescheiden unter den Mitgliedern der kleinsten Landesgruppe. Sie meldete sich so selten zu Wort, dass man ihre Anwesenheit fast vergaß.
Wie sehr es ihr auf die Nerven ging, protegiert zu werden, erlebte ich anlässlich eines Besuchs 1997 im zukünftigen Nationalpark Hainich in Thüringen. Eines meiner Projekte als Abgeordnete des Verteidigungsausschusses in der ersten Legislaturperiode nach der Vereinigung war, so viel Truppenübungsplätze der Nationalen Volksarmee und der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte wie möglich in die zivile Nutzung zu überführen. Als Abgeordnete von Thüringen lag mir der Hainich besonders am Herzen. Es gelang mir, zu Verteidigungsminister Rühe einen persönlichen Draht aufzubauen und ihn zu überzeugen, auf die Truppenübungsplätze dort zu verzichten. Merkel war im fünften Kabinett Kohl Umweltministerin. Ihr wurde vom Verteidigungsminister feierlich das Gelände übergeben, das Teil des zukünftigen Nationalparks sein sollte.
Rühe benahm sich wie ein großer Bruder, der seine kleine Schwester an die Hand oder in den Arm nehmen muss. Ich fing einen Blick von Merkel auf, der mir sagte, wie sehr sie es hasste, so behandelt zu werden. Jahre später, als nach dem Sturz des Partei- und Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Schäuble sich Volker Rühe als einzig verbliebener Kronprinz für beide Ämter sah, startete er einen Rundruf, um relevante Leute zusammenzutrommeln, die ihn in beide Ämter hätten befördern können. Dabei rief er auch bei Merkel an. Sie beschied Rühe: Parteivorsitzende werde sie selbst. Rühe lachte, hielt es wohl für einen Scherz, bis er eines Besseren belehrt wurde.
Der Vollständigkeit halber sollte ich hinzufügen, dass Rühe weder Parteivorsitzender noch Fraktionsvorsitzender wurde. Als die CDU-Spendenaffäre Wolfgang Schäuble erreichte, war ich Mitglied des Fraktionsvorstandes. Wir hatten gerade auf einer schwierigen Tagung beschlossen, den Beteuerungen Schäubles Glauben zu schenken und ihn als Fraktionsvorsitzenden zu bestätigen, als ein Bote eintraf, der Schäuble zur Zusammenkunft der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, deren Vorsitzender Norbert Lammert war, bat – nein, befahl. Wir warteten weit über eine Stunde auf die Rückkehr Schäubles. Als er endlich erschien, teilte er uns nur knapp mit, dass er als Fraktionsvorsitzender zurückträte. Er gab auch den Parteivorsitz auf. In der Fraktion gelang es Schäuble, Friedrich Merz als Vorsitzenden zu installieren. So sollte verhindert werden, dass der oder die künftige Parteivorsitzende auch automatisch Kanzlerkandidat(in) werden würde. Merz gelang es in zwei Jahren nicht, in der Fraktion eine eigene Hausmacht aufzubauen, da er auch Leute vor den Kopf stieß, die inhaltlich auf seiner Seite waren. Er wagte es nach der Wahlniederlage
2002 nicht, seinen Vorsitz in einer Kampfabstimmung gegen Merkel zu verteidigen. Nun lagen Partei- und Fraktionsvorsitz wieder in einer Hand. Der Weg zur nächsten Kanzlerkandidatur war frei. Dem verdatterten Edmund Stoiber entfuhr der Satz, niemand hätte ahnen können, dass Merkel so hoch ziele.
Auszug aus dem Buch „Ist mir egal: Wie Angela Merkel die CDU und Deutschland ruiniert hat“ von Vera Lengsfeld. AchGut Edition, 25 Euro.
Neueste Kultur
Spendenaufruf
+++ Haben Sie Interesse an politischen Analysen wie diesen?
+++ Dann unterstützen Sie unsere Arbeit
+++ Mit einer Spende über PayPal@TheGermanZ
oder einer Überweisung auf unser Konto DE03 6849 2200 0002 1947 75 +++
Klaus Kelle, Chefredakteur